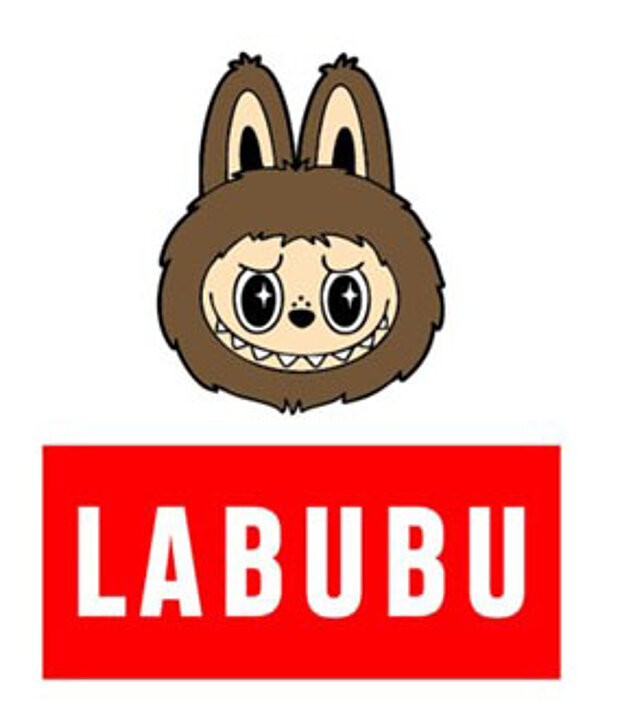Hauptinhalt:
Angriff der Plüschmonster: Labubu und der Musterschutz
Der Hype um Labubu-Figuren zeigt: Der Schutz von geistigem Eigentum steckt voller Tücken. Und manchmal ist das größte Hindernis dabei der eigene Erfolg.
Ob Trolle, Furby oder Hello Kitty – und jetzt eben Labubu: Alle paar Jahre erobert ein neues Trendprodukt die Welt im Sturm. Und während der eine Teil der Weltbevölkerung nur die Stirn runzelt, denkt der andere Teil: Das MUSS ich haben!
Anatomie eines Hypes
Im Fall von Labubu begann alles mit Kasing Lung, einem Illustrator und Spielzeugdesigner aus Hongkong. 2015 schuf er die Figuren-Serie „The Monsters“, die alsbald über die Shops und Automaten der chinesischen Spielzeugfirma Pop Mart verkauft wurde.
Der Clou bei diesen Automaten: Die Actionfiguren und Plüschtiere kommen in sogenannten „Blind Boxes“ daher – man weiß also nie genau, welche Figur man kauft.
Dass ausgerechnet Labubu, das Monster mit dem neunzähnigen Grinsen, weltweite Popularität erlangt, liegt an einem anderen Phänomen aus Asien, das für Außenstehende nur schwer verständlich ist: K-Pop.
Als an der Handtasche von Lisa Manobal, einem Mitglied der K-Pop-Gruppe Blackpink, im April 2024 ein Labubu-Schlüsselanhänger gesichtet wird, kommt es zum perfekten Sturm: Die gewaltige Nachfrage von Blackpink-Fans trifft auf das künstlich verknappte Angebot in den Pop-Mart-Automaten. Man muss kein Wirtschaftsgenie sein, um das Ergebnis vorherzusehen: lange Schlangen, steigende Preise und ein weltweiter Hype – angefacht von weiteren Labubu-Fans wie Rihanna, der Thai-Prinzessin Sirivannavari oder Madonna.
Eine geniale IP-Strategie?
Hinter dem Erfolg steckt eine ausgeklügelte Strategie: Pop Mart nimmt regelmäßig neue Künstlerinnen und Künstler unter Vertrag deren Werke vom Design über Produktion und Marketing bis zum Vertrieb zentral von Pop Mart gemanagt und auf die Zielgruppe (junge Frauen von 18 bis 29) zugeschnitten werden. Kampagnen auf TikTok und gezieltes Product Placement bei Prominenten sorgen für Mundpropaganda.
Doch die IP-Strategie hatte einen Haken: Offenbar wurde Pop Mart von der Wucht des weltweiten Hypes überrascht. Erst Mitte September 2024 meldete man die Wortmarke LABUBU (1819536) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) an.
Es kam allerdings sofort zu konkurrierenden Markenanmeldungen und Widerspruchsverfahren – etwa mit dem türkischen Inhaber der Bildmarke BUBU (019101166), der Verwechslungsgefahr witterte. Welches Markenrecht am Ende aufrecht bleibt, wird sich erst zeigen, wenn diese Verfahren abgeschlossen sind.
Ein Muster nach jedem Geschmack
Eine andere Möglichkeit, Labubu zu schützen, ist der Designschutz: Mit der Anmeldung eines Geschmacksmusters kann man das Aussehen eines Produkts registrieren – und andere für maximal 25 Jahre davon abhalten, ein zu ähnliches Produkt in Verkehr zu bringen.
Hier wird plötzlicher Erfolg allerdings zum Problem: Eine Musterregistrierung kann wegen mangelnder Neuheit für nichtig erklärt werden, wenn ein Produkt schon vorher bekannt und erfolgreich war. Und offenbar ist das passiert, bevor man bei Pop Mart an Musterschutz für die EU gedacht hat.
Grundsätzlich sind in der EU auch nicht eingetragene Geschmacksmuster geschützt. Hier ist es aber schwieriger, einen Nachweis für die Verletzung der eigenen Schutzrechte zu erbringen. So muss man der Gegenpartei etwa nachweisen können, dass sie das geschützte Geschmacksmuster vorsätzlich nachgebildet hat.
Wenn alle Stricke reißen, gibt es natürlich noch das Urheberrecht: Als Urheber von Labubu kann der Künstler Kasing Lung gemeinsam mit Pop Mart gegen dreiste Kopien seiner Monster vorgehen. Doch hier sind die Hürden höher und die Nachweispflichten strenger als bei Marken oder Designs.
Kurzum: Zumindest für Europa können wir uns also auf eine Schwemme von Labubu-„Dupes“ gefasst machen. Anders als Plagiate versuchen Dupes nicht, das Original perfekt nachzuahmen, sondern bieten eine ähnliche, günstigere Alternative zum Originalprodukt – die juristisch schwerer einzufangen ist.
Die Billigsdorfer-Labubus haben sogar schon einen eigenen Namen: Lafufus.